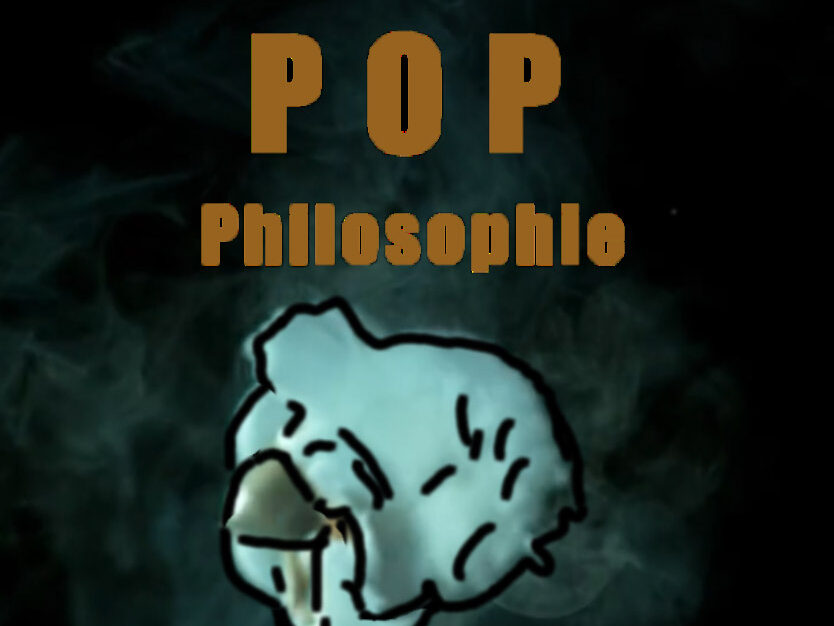Zur Kritik an den Covid-19-Maßnahmen
Während des Shutdowns nahm ich einige Bücher in die Hand, die lange im Regal standen und nicht gelesen wurden – eines behandelt die Philosophie als Beruf. Hier schreibt Margherita von Brentano mit Verweis auf Max Weber, dass die Gefahr in der wissenschaftlichen Spezialisierung dazu führen könnte, dass das eigene Wissen nicht mehr in den Gesamtkontext eingeordnet werden könne.1 Viele sprechen Sucharit Bhakdi oder Wolfgang Wodarg, die gegen die Corona-Maßnahmen Einspruch erhoben, ein Spezialwissen, nämlich das der Virologie und speziell der Kenntnis der Covid-19-Viren ab. Sie könnten keine allgemeine Aussage darüber treffen, weil sie eben keine Spezialisten seien. Auf der anderen Seite argumentiert der tatsächliche Experte Christian Drosten zurückhaltend: Er könne etwas über Viren sagen, aber nicht Handlungsanweisungen geben, wie sich politisch entschieden wird, weil er pädagogische, soziologische oder wirtschaftliche Faktoren nicht beurteilen könne. Wenn er eigene Meinungen im Podcast Coronavirus-Update des NDR äußert, versucht er transparent offenzulegen, wenn er Privatäußerungen trifft. Nun ist dieses genannte Philosophie-Buch bereits vierzig Jahre alt. Die starke Spezialisierung hat längst Einzug in so viele Lebensbereiche erhalten. Es gibt keine Leitfigur, die entscheidet, was richtig und falsch ist – und so scheiden sich in jenen Momenten, wo solide Daten und Fakten noch nicht ausreichen um klare Aussagen zu treffen, die Geister. Ich muss zugestehen, dass mir die Argumente der Gegner des gesundheitspolitischen Umgangs mit der Pandemie unklarer scheinen, als ihrer Gegenpartei. Drosten wirkt auf mich in diesem Kontext glaubwürdiger – und ich möchte Titel wie Verschwörungstheoretiker in diesem Kontext vermeiden. Als Philosoph halte ich es prinzipiell erst einmal gut zu hinterfragen.
Deshalb will ich mit meinem Blog-Essay kein spezifisch inhaltliches Thema auswählen, sondern die grundlegenden Argumente von Kritikern der Covid-19-Maßnahmen untersuchen. Dies soll meine Glaubwürdigkeitswahrnehmung konkret argumentativ untermauern. Dass in Rente gekommene Wissenschaftler oder Mediziner plötzlich Youtube-Videos veröffentlichen ist bereits ungewöhnlich und der Drang sich Gehör zu verschaffen, scheint ihnen wichtig genug zu sein. Die neue Möglichkeit des Publizierens über soziale Medien schafft ungehörten Stimmen ein Sprachrohr. Zudem stellen sie eine Basis dar, um sich zu vernetzen. Bhakdi und Wodarg konnten sich als Kritiker zusammenschließen, um einen Verein zu gründen: Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. Weiterhin hat Bhakdi mit Karina Reiss, Biologin und ebenfalls Vereinsmitglied, das Buch Corona Fehlalarm – Zahlen, Daten und Hintergründe veröffentlicht, aus dem ebenfalls Argumente hervorgehen. Stichprobenhaft werde ich folgend einige Aussagen auf argumentative Stringenz überprüfen:
Argument 1: Das Virus ist gezielt gesucht worden, deshalb werde seine Gefahr künstlich verstärkt.
Dieses Argument ist einleuchtend. Wenn ich mich auf die eine Kakerlake in meinem Keller fokussiere, ist der Schritt nicht weit, dass ich von einer Kakerlakenplage ausgehe, obwohl ich seit Wochen nur diese eine gesehen habe. Die Furcht vor Terrorismus führt dazu, verstärkt vermeintliche Terroristen im eigenen Umfeld zu entdecken. Das Ähnliches auch beim neuartigen Virus geschieht, ist insofern nichts Ungewöhnliches. Verstärkt wird diese Panik zudem, weil das Virus außerhalb der menschlichen Wahrnehmung existiert. Wir können es nicht sehen, wir erkennen lediglich die Folgen seiner Existenz. Das Argument ist insofern schlüssig. Man kann daraus allerdings nicht folgern, dass die Gefahr deshalb nicht existiert. Wenn ein Bus hinter einem Hügel brennt, ich nur die Rauchwolken dieses Busses wahrnehmen kann und in der Panik, dass dieser Bus jeden Moment explodiert, Vorkehrungen treffe, damit er eben nicht explodiert, ändert die Folge in Panik die Vorkehrungen zu treffen nichts an der Ernsthaftigkeit der Gefahr einer Busexplosion. Insofern sollte diese Aussage nicht zur Folgerung führen, die Gefahr existiere nicht. Die künstliche Verstärkung einer Gefahr bedeutet nicht, dass diese Gefahr keine ist. Erst der Beweis, dass eine Gefahr keine ist, wenn zum Beispiel ein*e Hubschrauberpilot*in über dem Bus fliegt und mir per Funk bestätigt, dass die Wolken von einem Lagerfeuer stammen und nicht vom Bus, wird mir deutlich, das ich übertrieben reagiert habe. Es sollte niemand für zu starke Vorsicht angegriffen werden.
Argument 2: Die Gefahr ist überschätzt worden, weil nicht zwischen Erkrankung und Infektion unterschieden wird.
Was ist der Unterschied zwischen Erkrankung und Infektion? Die Erkrankung ist eine Folge der Infektion. Durch einen anderen Menschen infiziere ich mich mit Covid-19, das bedeutet, ich bin noch nicht krank, weiß auch noch nicht, dass ich krank bin. Ab einem gewissen Punkt bin ich in der Lage andere Menschen zu infizieren, vielleicht bevor ich selbst weiß, infiziert worden zu sein oder weil mein Krankheitsverlauf asymptomatisch (infizierte Patient*innen werden nicht krank) verläuft. In letzten Fall werde ich ohne Nachweis nicht erfahren, ob eine Infektion bestand oder nicht. Nun bedeutet Infektion nicht Krankheit, in diesem Sinne ist eine Unterscheidung angebracht, aber welcher Begriff ist nun relevant für die Gefahreneinschätzung? Nehmen wir an, alle Menschen infizieren sich an einem Virus, aber werden nicht krank. In diesem Fall ist die Infektion keine Gefahr. Wenn nun alle Menschen, die sich am Virus infizieren, krank werden, ist die Gefahr für alle gleich. Nun ist die sogenannte Dunkelziffer ungewiss aufgrund der Situation, dass es eine relativ hohe Zahl von Infizierten gibt, die keine Symptome aufweisen und asymptomatisch sind. Das kann auch die Sterberate wesentlich beeinflussen: Wenn also 240.181 bestätigte Fälle existieren und pauschal die Dunkelziffer 40% beträgt, hätten wir in Wirklichkeit 400.301 Infizierte. Die Sterberate liegt also bei der aktuell bestätigten Zahl bei 3,7% und bei Einbeziehung der Dunkelziffer 2,2%. Das ist durchaus ein Unterschied. Die Todesrate reduziert sich insofern bei mehr Infizierten.
Ist dann also auch die Gefahr geringer? Denken wir an die exponentielle Steigerung der Infizierten am Ende des letzten Jahres. Durch den langen Krankheitsverlauf bis zum Tod (ca. 4 Wochen oder länger) bedeutet eine Steigerung der Infizierten nicht automatisch eine geringere Sterberate. Sie ist schlicht und einfach aktuell noch nicht nachzuweisen und hätte auch zu Beginn des Shutdowns nicht nachgeprüft werden können. Der Unterschied zwischen Erkrankung und Infektion ist wichtig. Beide Begriffe sind aber nicht eindeutig voneinander abzugrenzen. Das Gedankenspiel, wenn alles eine Farce gewesen wäre, das heißt tatsächlich die Gefahr überschätzt und alles nicht so schlimm gewesen wäre, will ich später näher beschreiben.
Argument 3: Der sogenannte Drosten-Test ist falsch-positiv.
Unabhängig von der medizinischen Sicht: Nehmen wir einmal an, der Test ist tatsächlich falsch-positiv. Das würde bedeuten, dass Menschen als positiv getestet werden und glauben, sie seien infektiös ohne es zu sein. Bei einer Fehlerquote von 2% bedeutet das, von 100 Menschen wären 2 Menschen nicht infektiös. Wie im Busbeispiel wären die Vorkehrungen stärker als es evtl. im Sinne der Gefahr angebracht wäre. Kommen wir noch einmal zurück zu Argument 2: Die Totenzahlen betreffen die wahrscheinlich durch Covid-19 Erkrankten und Verstorbenen, die vormals infiziert waren. Es ist wie bereits beschrieben durchaus gerechtfertigt hier zwischen Erkrankung und Infektion zu unterscheiden. Von der Infektion werden „lediglich“ weitere Menschen infiziert, was nicht direkt bedeutet, dass sie krank werden bzw. sterben. Die Gefahr entsteht durch die Infektion, da sie sich exponentiell steigern und über eine gewisse Inkubationszeit verbreitet werden kann. Nun kommen wir zu einem ethischen Problem: Infiziere ich mich und handle nicht nach gewissen Bedingungen, habe ich Verantwortung darüber ein Virus zu verbreiten und ggf. Menschen damit zu infizieren (ich will hier noch nicht direkt von töten sprechen), das heißt ich nehme bewusst in Kauf, dass die Pandemie unkontrollierte Züge annehmen kann. In diesem Kontext ist meine Verantwortung als Infizierter sogar höher als als Erkrankter, der die Folgen des Virus zu spüren bekommt.
Zurück zum Argument: Wenn nun der Drosten-Test zu 2% falsch-positiv ist, hat dies keine negativen Auswirkungen auf die Getesteten, außer dass diese für zwei Wochen in Quarantäne müssen, um sich und andere zu schonen. Negative moralische Auswirkungen wären, wenn durch die Quarantäne weitere Menschen getötet werden würden, vielleicht weil die Person in Quarantäne Herzchirurg*in ist und durch die zwei Wochen viele Patient*innen ums Leben kommen. Oder unvorhersehbare Fälle, wie dass ein Kreuzfahrtschiff in Quarantäne gesetzt wird und Menschen aus anderen Gründen dort ums Leben kommen. Hier wäre interessant, die Konsequenzen in Zahlen einschätzen zu können. Intuitiv bezweifle ich aber, dass die Folgen eines falsch-positiven Tests mehr Tote verursachen, als dass die anderen 98%, wenn sie nicht getestet würden und nichts von ihrer Verbreitung wüssten.
Führen wir das Gedankenspiel weiter aus und gehen davon aus, dass die Sterberate tatsächlich die einer normalen Grippewelle wäre, was man wohl angesichts der Zahlen der letzten Monate nicht mehr behaupten kann. In diesem Fall würden die Maßnahmen eben auch die Grippewelle eindämmen (wie auch geschehen), was lediglich bedeuten würde, dass in unserer Gesellschaft aktuell die Gesundheit als moralischer Wert eine hohe Aufmerksamkeit bekommt. Daraus abzuleiten, dass wenn die Covid-19-Gefahr einer Grippewelle ähnelt, keine Maßnahmen getroffen werden sollten, wäre eine Ethik, welche die statistischen, geringen Sterberaten gegenüberstellt und daraus politische Handlungs-anweisungen ableitet. Hier müsste auch abgewogen werden, wie viele Opfer beispielsweise dadurch entstünden, dass andere Krankheiten nicht erkannt werden oder Menschen sich trotz einer anderen Erkrankung wegen Covid-19 nicht in die Krankenhäuser trauen. Diese Dunkelziffer aufzuklären würde eine Sozialstudie nach sich ziehen.
Philosophisch wären Konsequenzen hinsichtlich direkter Auswirkungen durch Covid-19 den Folgeerscheinungen vorzuziehen. Wir haben es hier mit einer sogenannten teleologischen Ethik zu tun, zu der in diesem Kontext auch der utilitaristische Vergleich gehört. Es wurde davon ausgegangen, dass der Shutdown ein größeres Überwiegen des Guten über das Schlechte herbeiführt. Ob dies erfolgreich war, wissen wir nicht, weil es die aktuellen Informationen und erst recht die zu Beginn des Shutdowns nicht zulassen oder zugelassen haben. Das heißt die Entscheidung „Shutdown oder nicht“ ist keine eindeutige. Eine bessere oder schlechtere Lösung ist (noch) nicht als Faktum erkennbar. In diesem Kontext sind Argumente 2 und 3 sinnvoll – aber daraus die Konsequenzen zu ziehen, die Regierung habe im Sinne dieses moralischen Dilemmas falsch gehandelt, impliziert dass ein richtiges Handeln möglich gewesen wäre. Und das ist Quatsch, denn kein Land konnte in dieser weltweiten Pandemie bisher eindeutig richtig oder falsch handeln.
Argument 4: Den deutschen Bürgern wird ihre Mündigkeit abgesprochen. Freiheitsrechte werden beraubt.
Dieses Argument ist das Hauptargument der Gegner*innen gegenüber den Covid-19-Maßnahmen in Deutschland. Welches sind denn die Freiheitsrechte? Aufklärung bietet hier auch nicht die Internetseite des gegründeten Vereins.2 Der verwendete Begriff von Freiheit wird insofern nicht näher definiert oder seine Verwendung eindeutig klargestellt. Nicht aus juristischer, sondern aus argumentationstheoretischer bzw. philosophischer Perspektive möchte ich mir die betreffenden Artikel anschauen: §2 (1) GG: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ § 2(2) GG „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ Der letzte Satz ist interessant. Gesetze können jene genannten Rechte aushebeln? Sonst wären Gefängnisstrafen für Straftäter wohl nicht im Sinne des Grundgesetzes. Mein oben beschriebenes moralisches Dilemma macht deutlich, inwiefern die eigene Freiheit, nämlich keine Maske zu tragen, die Gesundheit der anderen Menschen einschränken kann. Es ist ein aus dem Verhältnis von Legislative, Exekutive und Judikative entsprungenes Recht. Freilich nach dem Artikel 1 eines der höchsten Rechte und gleichzeitig eingeschränkt. Die Mündigkeit der Staatsbürger*innen ist insofern dem Staatsapparat als Institution unterworfen. Unabhängig davon wäre auch noch zu klären, was Mündigkeit bedeutet. Die lässt sich aus seinem Gegensatz ableiten. „Unmündig ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“3 Wird dies eingeschränkt? Nein, sonst bestände keine Möglichkeit jene Argumente publik zu machen, geschweige denn das einleitend genannte Buch zu veröffentlichen. Für dieses Buch haben sich die Autor*innen Reiss & Bhakdi ihres Verstandes bedient, ohne Leitung des Staates. Es gibt aber auch Menschen, die sich nicht des Verstandes ohne Leitung bedienen, also unmündig bleiben wollen, aber dies selbst entscheiden. Kann man überhaupt unmündig sein als Bürger in der Bundesrepublik Deutschland? Hier besteht ein kleines Problem im Verstandesbegriff. Ich kann natürlich bewusst entscheiden meinen Verstand nicht zu bedienen, d.h. ich akzeptiere einfach alles, was vorgekaut wird, ohne darüber nachzudenken. Das ist hier allerdings nicht der Fall.
Argument 5: Menschenleben werden durch Folgen eines Shutdowns geopfert.
Auch dieses Argument kann man per se als richtig betrachten. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns sind ungewiss. Es ist die Frage der ethischen Wertigkeit und es wurde bereits erläutert, dass es in diesem moralischen Dilemma wohl keine eindeutige Lösung gibt. Nimmt man die Covid-19-Toten in Kauf oder die Folgen eines Shutdowns? Die Regierung hat sich für etwas entschieden, was sie als das kleinere Übel hält und gerade das Hinauszögern während der zweiten Welle hat das Hadern mit dieser Entscheidung bestätigt. Dass Menschenleben geopfert wurden, lässt sich per se nicht sagen. Das Argument ist insofern nur eine Behauptung, die nicht nachgeprüft werden kann. Ein weiterer Punkt spielt da eine zusätzliche Rolle: Wie ist der Handlungsspielraum einer Regierung in Krisensituationen und wie verhält sich die Judikative dazu? Denn das Rechtssystem kann diesen Spielraum einschränken. Gerade in einer Katastrophe, die plötzlich auftaucht, steht das gesamte System in Frage. Wie weit ist der Ermessensspielraum des Grundgesetzes? Wie willkürlich wirken gewisse Maßnahmen? Familienfeiern als Gefahr zu sehen, ist eine Einschätzung, die auf Abwägung der Ereignisse zielt, nicht auf Faktenanalyse. Kritiken wie bspw. gegenüber Sperrstunden sind berechtigt. Warum liegt es allerdings im Interesse der Mitglieder des Vereins beziehungsweise Bhakdins, Reiss‘ und Wodargs, Fehler der Regierung offenzulegen bevor man überhaupt weiß, ob es Fehler sind? Ihr Prinzip, lediglich auf Handlungsfehler hinzuweisen ohne selbst Vorschläge zu machen oder die Maßnahmen mit Diktatorischen Verhältnissen unter der NSDAP zu vergleichen, ist fragwürdig. Hier machen es sich die Autor*innen etwas einfach – die Frage, inwieweit der Staat unsere Freiheitsrechte einschränken kann, ist ein weitreichendes Thema und ist vom jeweiligen Kontext her zu berücksichtigen. Vergleiche mit dem Dritten Reich zu ziehen sind schwierig und effekterheischend, wenn auch eine Aufmerksamkeit für die Situation angebracht ist. Ein Zitat anzuführen, dass auf Hannah Arendt verweist, ist kein transparentes Argumentieren, denn ich als studierter Philosoph verstehe nicht, worauf die Autor*innen hinaus wollen. Wenn damit wahrscheinlich auf Arendts Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft hingewiesen wird, dann ist das ein sehr oberflächlicher Vergleich. So wie ich Arendt verstehe, beschreibt sie vor allem die Gefahr fanatischer Massenbewegungen, die Verbrechen legitimieren und durch Ideologien gestärkt werden. Ist die „Covid-19-Gefahr“ eine Ideologie? Welche Verbrechen werden legitimiert? Ist die Ausgangssperre und damit verbundene Konsequenzen ein Verbrechen? Werden Minderheiten durch die „Covid-19-Gefahr“ bedroht oder benachteiligt? Es gibt durchaus gerechtfertigte kritische Stimmen, wie dass klein- und mittelständische Unternehmen, Künstler*innen oder Veranstalter*innen benachteiligt werden, zum Beispiel von Stefan Homburg, ebenfalls Vereinsmitglied. Es scheint, dass das Interesse der Autor*innen bzw. des Vereins im Allgemeinen vor allem darin besteht, die Handlungen der Regierung zu hinterfragen. Leider machen sie sich durch krude Argumentation selbst angreifbar und hier liegt mein grundlegendes philosophisches Problem.
Alle Argumente haben eine nachvollziehbare Grundlage, die Kritik an Eingriffen in die bürgerliche Freiheit, vorschnelles oder ungewisses Handeln, falsche Risikoeinschätzung. Auf die Risikogruppen bezogen kann man durchaus anführen, dass Menschen in Altersheimen benachteiligt werden, weil sie nicht raus dürfen bzw. keine Besuche empfangen können. Auch dass sozial schwächere Menschen keine Möglichkeit haben über das Home Office ihrer Arbeit nachzugehen. Aber ist die Ausgrenzung dieser Gruppen nicht bereits ein von der Pandemie unabhängiges gesellschaftliches Problem?
Unsichere Wissenschaft
Am Ende meines Essays möchte ich noch einmal an meine Einleitung anknüpfen mit einem Zitat aus Foucaults Die Ordnung der Dinge: „Wenn der Mensch aber nicht mehr souverän im Reich der Welt steht, wenn er nicht im Zentrum des Seins herrscht, sind die ‚Humanwissenschaften‘ gefährliche Mittelglieder im Raum des Wissens. Diese Stellung aber weiht sie einer wesentlichen Instabilität.“4
In ihrer Konkurrenz zu einer Philosophie die glaubt allumfassende Antworten zu geben, die kaum gegeben werden können, steht auch die Medizin in einer problematischen Stellung. Aus diesem Grund scheint der Verein mit seiner humanistisch-paradoxen Zielsetzung, neben der medizinischen Aufklärung auch politische Aufklärung zu betreiben, zu misslingen. Alle Argumente, die ich hier unvollständig beispielhaft aufgezählt habe, benötigen einen interdisziplinären Diskurs. Vom wissenschaftlichen, empirischen Standpunkt ausgehend können Aussagen nach wie vor noch nicht getroffen werden. Die Instabilität, in der sich die Medizin aktuell befindet, ist keine Neuigkeit, insofern ist sie auch nicht die Rettung aus der Not. Katastrophen-Expert*innen können bestmögliche Bedingungen schaffen die Katastrophe zu beschwichtigen, können sie aber nicht verhindern. Die Pandemie beinhaltet so viele unterschiedliche Kontexte: Wie die Verfassung funktioniert, wie die Politik in Deutschland handelt, was wirtschaftliche Faktoren sind, Bedingungen der Pflege, soziale Aspekte, psychologische Einflüsse, Pädagogik, Mediendiskurse (auch die der sozialen Medien), was eigentlich Fake-News sind, Machtinteressen usw. Dieses Geflecht an Information verunsichert bereits, weil ein einheitliches Wissen hier nicht geschaffen werden kann. Es gibt eben keine klare Handlungsanweisung: „Wir haben eine Pandemie, also handeln wir soundso!“ Wir Menschen merken in diesem Kontext, dass Wissenschaft nicht allwissend ist, dass sie Grenzen hat, dass Statistiken Interpretationsspielraum besitzen, dass je nach Fragestellung andere Antworten herauskommen. Das ist die Unsicherheit, nicht nur als Folge „unsicherer Zeiten“. Diese Erkenntnis ist nicht neu und auch keine Konsequenz des Virus, sie legt lediglich offen, was gerne allgemein verdrängt wird:
Wir leben stets in unsicheren Zeiten, die Frage ist, ob wir lernen besonnen damit umzugehen. Und: Wissen ist stehts unsicher – alles ist Falsifizierbar. Aber ist es nicht schön, wenn Wissen im Fluss ist? Ist es nicht beruhigend, dass wir Menschen niemals den Hegelschen Weltgeist erreichen können, also alles wissen und verstehen? Ein Buch, das ich als Jugendlicher gelesen habe hat mir dies anschaulich gemacht. Es ist die Fortsetzung von H.G. Wells Zeitmaschine und heißt Zeitschiffe von Stephen Baxter. Dort haben die Morlocks eine ideale Welt erschaffen, indem sie eine Sphäre um die Sonne errichtet haben, in der alle gleich sind und für eine Erweiterung des Wissens arbeiten. Nahrung ist für alle vorhanden, die Energie kommt direkt von der Sonne. Die Welt ist ideal, aber langweilig. Veränderung belebt und vermeidet, dass wir im Koma des Status Quo, also unserer Trägheit landen. Ein moderner, reflektierter Wissenschafter weiß das und vermittelt das auch so – Wissen ist nie absolut. An diesem Punkt werden auch noch an selbsternannte Fakten glaubende Humanwissenschaftler*innen akzeptieren müssen, dass sie im Kontext ihrer Antworten transparent mit diesen Unsicherheiten umgehen sollten und sich mit den philosophischen Aspekten dahinter abfinden, vielleicht sogar damit umgehen müssen. Zudem wird hier deutlich, dass die Spezialisierung diese Unsicherheiten nur noch verstärkt. Wenn ich in meiner Blase gefangen bin und nicht mehr über den Tellerrand hinaus schaue, mich dem Diskurs auch gegensätzlicher Wahrheiten nicht stelle, muss ich mich mit der Angst vor dem Abgrund abfinden. Vielleicht ist nun wieder die Möglichkeit für uns Philosoph*innen und Geisteswissenschaftler*innen gekommen, mehr gehört zu werden, weil wir genau mit dieser Unsicherheit bereits mit dem ersten Lesen philosophischer Texte konfrontiert wurden und damit umzugehen gelernt haben. Aber auch hier gibt es scheinbar immer noch Lehrer*innen und Dozent*innen, die glauben zu wissen, wie man „Ihren“ Goethe oder Kant zu interpretieren hat. Deshalb freue ich mich über Menschen, die in der Lage sind, die Grenzen ihres Wissens und etwaige Fehler einzugestehen. In diesem Sinne kann ich den Verein nur dazu ermuntern, weiter an den Argumenten zu feilen und vielleicht hier auch zu erkennen, was es bedeutet Wissenschaft zu betreiben.
1Vgl. Margherita von Brentano, in: Philosophie als Beruf, hrsg. v. Joachim Schickel, Frankfurt am Main: Fischer 1982, S.70.
2 https://www.mwgfd.de/ (zuletzt am 29.08.2020 besucht)
3 Kant AA VII: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, S. 35.
4 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, übers. v. Ulrich Köppen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974, S.418.