In der „Politeia“ von Platon möchte Sokrates die Dichter aus seinem idealen Staat hinauswerfen, weil ihre Geschichten eine Gefahr für Erziehung und Ausbildung darstellen. So seien die Dichter nur Erzeuger von Schattenbildern, die scheinbar Wirklichkeit darstellen und durch ihre starke emotionale Färbung schlechten Einfluss auf die Menschen haben. Wenn man es konsequent zu Ende denkt, stellt jede Fiktion für einen Wahrheitsliebenden, das impliziert auch Philosoph*innen, eine Bedrohung dar.
Der Einfluss gedichteter Geschichten politischer Autoritäten auf die Wahrnehmung dieser hat sich auch im digitalen Zeitalter kaum verändert. Ob Königsmythen, die mit Fiktionen herrschaftliche Macht stärkten oder die diversen Gründungsmythen, die sich um die großen Technologiefirmen wie Apple, Facebook oder Microsoft ranken. Alle sind Dichtungen einer Herrschafts-geschichte und manipulieren das Bild der Menschen an der gesellschaftlichen Spitze. Auf die „Mythen des Alltags“ wies Roland Barthes in den 1960er Jahren hin. Mit feinfühligem Gespür sezierte er die Widersprüche in solchen Alltagsmythen zwischen Wahrheit und Fiktion und wie diese alles Kritische in einem neuen Mythos einverleiben. Die Dialektik der Mythen – untersuchen wir sie am Beispiel Amazon: Jeff Bezos entwickelte die Firma aus dem Ideal heraus, jederzeit, überall auf ein globales Bücherangebot zugreifen zu können. Sein Fokus liegt bei den Kunden, weshalb die Preise günstig sind und der Versand meist kostenlos. Zudem unterstützt man mit dem Erfolg der Firma das Vorhaben „Blue Origin“ mit dem das Universum besiedelt werden soll.
Der Mann ist ein Philanthrop – er versucht das Universum zu erkunden, um der Menschheit eine Zukunft zu geben.
These: Jeff Bezos ist ein Philanthrop, dem seine Kund*innen wichtig sind.
Aber er behandelt seine Mitarbeiter*innen sehr fragwürdig. Er zerstört mittlere und kleinere Unternehmen, kann Verlage unter Druck setzen – kurz er ist ein Monopolist. Beim Axel Springer-Award 2018 behauptete er, sich jede Kritik anzuhören und zu überprüfen, ob sie stimme. Er ist also selbstkritisch. Scheint aber nicht wahrnehmen zu wollen, dass es seinen Mitarbeitern nicht gut geht.
Antithese: Jeff Bezos ist ein Monopolist, den seine Mitarbeiter*innen nicht interessieren.
Zur Synthese, die aus diesen beiden Thesen gebildet werden sollte, indem sie beide mit einschließt und in diesem Punkt auch widersprüchlich sein muss: Sie zeigt wie Fiktion und Realität ein gegenseitiges Verhältnis eingehen, dem eine Paradoxie innewohnt. Und hier ist das Problem der Dichter im Staat benannt: Zum einen vergrößern sie die Ideologie und bestärken den Staat mit Geschichten. Zum anderen tun sie so als ob der Staat perfekt funktionieren würde, sie lassen die
Menschen vergessen den Staat zu kritisieren. Jene wechselseitige Beziehung ist im Realen notwendig und auch paradox. Sie zeigt, dass jedes Ideal einen unter-schwelligen, negativen Unterton hat.
Synthese: Jeff Bezos ist ein Philanthrop, dem die Kund*innen am wichtigsten sind. Wenn Mitarbeiter*innen unzufrieden sind, dann lügen sie, denn Jeff Bezos sind seine Mitarbeiter*innen wichtig.
Es ist unabhängig, ob Bezos von seiner Ideologie überzeugt ist oder dies nur vorgibt. Die Antithese zeigt, dass die Ideologie eine ist, die nicht ideal verwirklicht wird. Als Blase, die jeden Moment zu zerplatzen droht und die stets fliegen muss, um zu überleben, wird die Antithese in die Ideologie integriert und vergrößert die Blase. Amazon lebt von diesem Aufrechterhalten der Ideologie und ist dadurch erst erfolgreich geworden. Fiktion und Realität hängen im wechselseitigen Verhältnis zusammen. Die Realität (=Antithese) braucht die Fiktion (=These), um sich seiner selbst zu versichern. Aufgrund dieser Abhängigkeit kann sich die Fiktion als neue Wahrheit (Synthese) gegenüber der Antithese behaupten, sie integrieren und in einem neuen Mythos die Realität als Fiktion behaupten.
Sokrates fordert nach seiner Entscheidung, die Dichter aus dem Staat zu werfen, dass diejenigen aus der Verbannung zurückkehren können, wenn sie sich erfolgreich verteidigen. Das brauchen sie nicht. Denn sie behaupten den Mythos Vernunft als eine Fiktion – und hier ist die Gefahr. Aufgrund unserer Synthese als neue Wahrheit kann alles Vernünftige als Lüge entlarvt werden. Die Vernunft Platons versucht den Geschäftsmann fein säuberlich von anderen Berufen zu trennen. Aber auch dieser ist in der Lage zu dichten – wie wir es bei Bezos feststellen. Der ist Geschäftsmann, Politiker und glaubt, ein liberaler Mensch zu sein (oder hält diese Fiktion mit allen Mitteln aufrecht). In diesem Verhältnis wird deutlich: Der Konflikt zwischen Wahrheit und Fiktion ist diffiziler und nicht
offensichtlich. Eine Wahrheit löst die Fiktion nicht unbedingt auf, sondern bestätigt sie sogar. Im Prozess der Ideologie wird die Fiktion behauptete Wahrheit – es ist möglich Gegenargumente zu finden und Beweise, warum Bezos ein Lügner ist. In der Frage, wie seine Geschichte erzählt wird, ist das irrelevant. Ihr Mythos wird sogar durch jene Antithesen gestärkt. Mit dieser Paradoxie müssen wir jeweils umgehen.
In diesem Zug ist es einfach Coronaleugner*innen und Verschwörungs-theoretiker*innen die Wahrheit abzusprechen, weil sie sich eine eigene Fiktion erschaffen. Genauso ist auch die Fiktion einer „unsichtbaren Hand des Marktes“ wahr und unwahr. Oder eben die Fiktion, Amazon behandele seine Mitarbeiter gut. Ist dann alles Fiktion, dessen Wahrheit angezweifelt wird? Platon sinniert über einen Staat, der Tugenden so gut wie möglich fördert und unterstützt. Die Dichter sind der unkontrollierbare Faktor. Dieser Faktor kann aber bereits negiert werden durch die Erkenntnis, dass Dichter mit Schattenbildern arbeiten und nicht wahrheitsgemäß sind. Und dieselbe Argumentation verwendet Bezos – er spricht die Wahrheit – alles andere ist Dichtung.
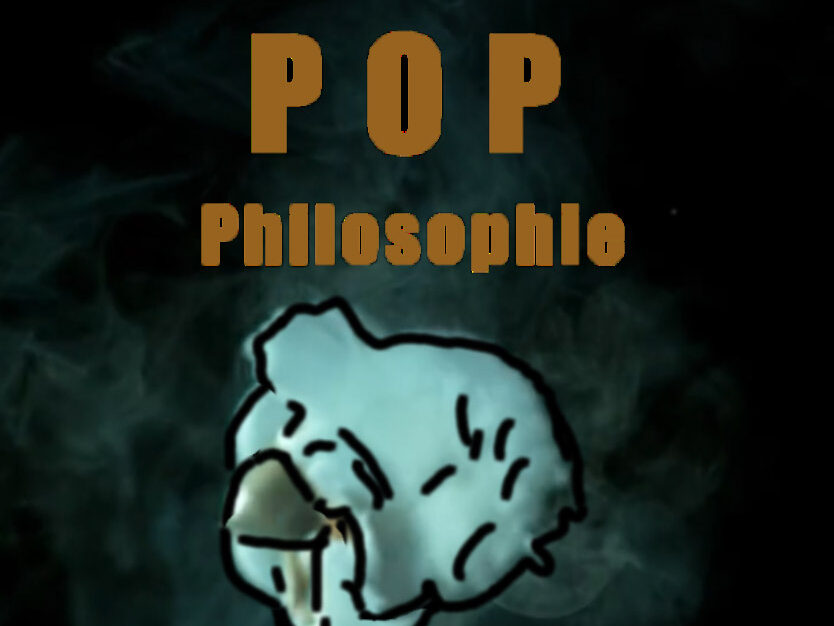
Schreibe einen Kommentar